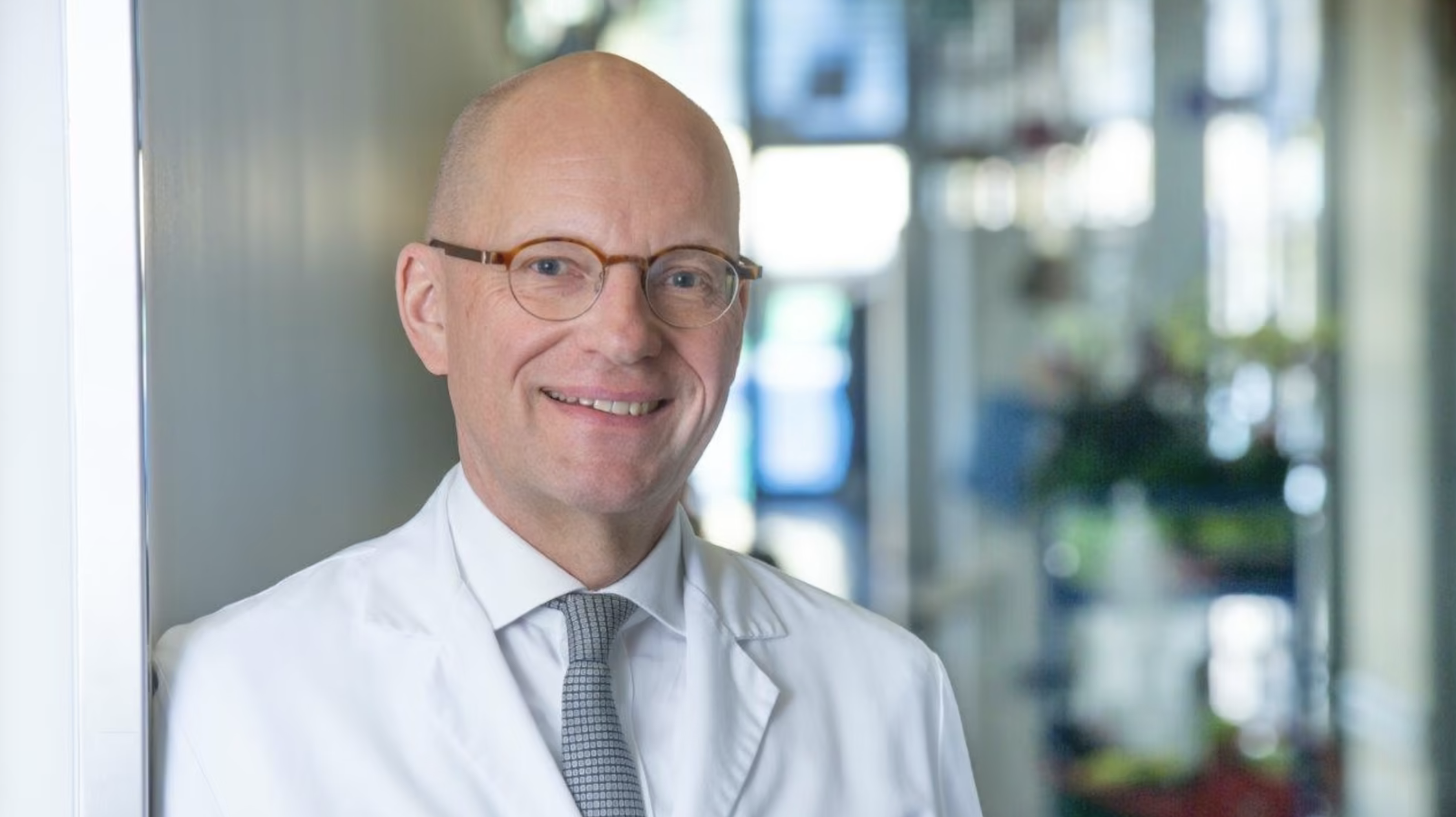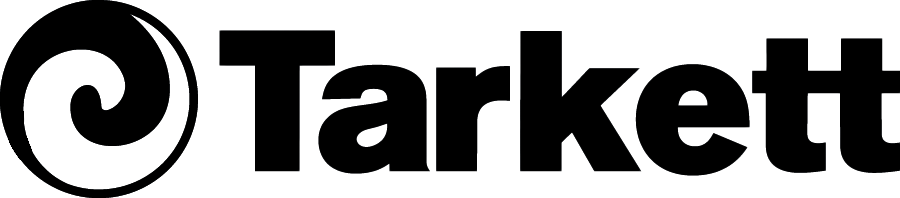Cornel Sieber ist ärztlicher Direktor für Kinder-, Jugend- und Altersmedizin am Klinikum Winterthur. Als Geriater hat er sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gearbeitet. (Foto: DGIM)
Cornel Sieber: »Wir leben in einer jugendverliebten Welt, in der das Alter keinen Platz hat«
Katinka Corts
Cornel Sieber ist ärztlicher Direktor für Kinder-, Jugend- und Altersmedizin am Klinikum Winterthur. Als Geriater hat er sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gearbeitet. (Foto: DGIM)
Herr Sieber, Sie befassen sich seit Jahrzehnten speziell mit der Altersmedizin. Doch obwohl die demografische Entwicklung die Bedeutung der Geriatrie und die Notwendigkeit altersgerechter Krankenhausarchitektur vorgibt, scheint sich nicht genug zu verändern und die Geriatrie ist noch immer nur eine optionale Zusatzweiterbildung. Wie beurteilen Sie den Stand der Dinge diesbezüglich?
Nun ja, als ich mit meinen Arbeiten zur Altersgesundheit begonnen habe, war Geriatrie noch nicht mal ein eigener Schwerpunkt! Mit den Jahren ist es uns gelungen aufzuzeigen, dass es ein zentrales und wichtiges Gebiet ist. Als Altersmediziner arbeiten wir aufgrund der Multimorbidität meist in interdisziplinären und interprofessionellen Teams. Gut 80 % der betagten Menschen haben viele Krankheiten auf einmal. Ich glaube, dass neuere Spitalstrukturen sich überproportional auf den demografischen Wandel einstellen müssen. Doch in Deutschland gibt es klassische »Organkliniken«, das heißt, der Lungenspezialist hat Betten genauso wie der Herzspezialist. Das passt nicht dazu, was wir in der Geriatrie brauchen. Dieser Zustand ist aber übrigens kein deutsches Phänomen, denn etablierte Geriatrieforschung gibt es bis heute in vielen Ländern Europas nicht.
Sie waren von 2017 bis 2018 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und von 2022 bis 2023 Präsident der European Geriatric Medicine Society. Als Mediziner sind Sie zudem immer nach an den Patient*innen. Welche Bedürfnisse alter Menschen werden nach Ihrer Erfahrung zu oft übersehen und was kann betagten Patienten in der ungewohnten Krankenhaussituation helfen?
Alte Menschen sind, allem voran, meist nicht mehr so flexibel. Kommen sie ins Krankenhaus, ist es ein Verlassen des normalen Umfelds. Viele haben große Angst, ein wenig kann man es mit den Unsicherheiten vergleichen, die Kinder in solch einer Situation spüren. Im Vergleich zu diesen steht bei Betagten jedoch nicht das Geborgensein und das Wohlfühlen im Vordergrund, vielmehr sind es große Bedürfnisse hinsichtlich Sicherheit und Orientierung. Das ist unabhängig davon, ob jemand kognitiv eingeschränkt ist oder nicht.
Es braucht also gute Signaletik, einen hohen Wiedererkennungswert der Räume und es muss meiner Ansicht nach eine Architektur sein, die Stille und Ruhe vermittelt. Unsere Patient*innen sind als Hochbetagte um die 85 Jahre alt und leben zu Hause natürlich völlig anders. Es ist wichtig, dass Planende ein Spital nicht aus der Sicht ihrer Generation bauen, sondern mit klarem Blick auf die Leute, die darin Patienten sein werden.

Im universitären Zentrum für stationäre und ambulante Altersmedizin Felix Platter in Basel heißt ein großzügiges Foyer Patientinnen und Patienten genauso wie Besuchende willkommen. (Foto: Universitäre Altersmedizin Felix Platter)
Können Sie dazu konkrete Beispiele aus der Praxis nennen?
Bei der Planung gehen oft kleine, aber sehr wichtige Details vergessen: Was nützt mir zum Beispiel ein einseitiger Handlauf in einem Gang? Welche Seite nach einem Schlaganfall gelähmt ist, kann man nicht »wählen« – und wenn es keinen Handlauf auf der für die Patientin entscheidenden Seite gibt, ist der Ort nicht barrierefrei.
Da alten Menschen oft die Orientierung schwerer fällt, erhöhen zu viele Ecken und Kanten im Raum und schlechte Lichtverhältnisse die Verletzungsgefahr. Wichtig ist auch, dass Nasszellen groß genug sind, damit Hilfsmittel gut eingesetzt werden können. Im Endeffekt kann man sagen, dass traurigerweise die wenigsten Krankenhäuser wirklich für alte Menschen gebaut sind, obwohl diese einen sehr großen Anteil der Patienten stellen.
Wie könnten Missstände wie diese behoben werden? Sind ungenügende Planungen schuld an den genannten Problemen oder beginnt es schon früher, bei der korrekten Formulierung der Bauaufgabe seitens der Bauherrschaften?
Der einfachste Weg ist wohl, bei Planungen relativ früh die direkt Betroffenen einzubeziehen. Medizinal- und Pflegepersonal kennen die Umstände der Betreuung sowie die notwendigen Abläufe genau, zudem gibt es an jedem Ort lokale Faktoren zu berücksichtigen. Auf einer altersmedizinorientierten Station braucht man für Verbandsmaterialien, Einlagen, Rollstühle und Gehhilfen sehr viel mehr Lagerräume als in gängigen Spitalabteilungen. Da für alte Menschen jeder Ortswechsel eine große Anstrengung bedeutet, ist es sinnvoll, auch die Informationen der physikalischen Therapie einzuholen.
Wir müssen aber auch immer wieder konstatieren, dass Altersmedizin nach wie vor nicht attraktiv ist. Wir leben nun mal in einer jugendverliebten Welt – in dieser überhaupt ein Geriatriespital bauen zu dürfen, ist bisher ein Luxus. Häufig werden einfach bestehende Strukturen in Geriatrien umgebaut, was mal besser, mal schlechter gelingt.
Dabei entscheidet für alte Menschen eine Therapie meist darüber, ob sie wieder ins häusliche Umfeld zurückkehren können oder ins Pflegeheim umziehen müssen. Und genau das muss man im Hinterkopf haben, wenn man eine Geriatrie plant: Wir brauchen Räume, die vieles ermöglichen, breite Gänge sowie genügend Therapieräume für Einzel- und Gruppentherapien. Man braucht Physio- genauso wie Ergotherapie und auch Möglichkeiten, »Lebenspraxis« zu üben. Dazu gehören auch Therapieküchen, in denen die Patienten einfache Handlungen üben oder wieder erlernen können, die sie zu Hause brauchen.

Das Architektenteam Holzer Kobler und wörner traxler richter haben bei der Gestaltung des 2019 fertiggestellten Gebäudes auf die besonderen Anforderungen und längeren Liegezeiten älterer Patientinnen und Patienten geachtet. (Foto: Universitäre Altersmedizin Felix Platter)
Es geht also vor allem um zusätzliche Flächen, die normalerweise nicht in Spitälern vorgesehen sind oder aus Kostengründen gestrichen werden. Doch alles, was nicht ein Bett ist, ist doch unter dem Strich kein Einkommen im Krankenhaus.
Es stimmt schon, dass wir ständig sparen müssen. Deshalb braucht es in einem Planungsgremium auch wirklich Leute, die entscheiden, was essenziell ist. Denn es gibt besonders bei der technischen Ausrüstung auch Dinge, die eher »nice to have« sind, die aber z. B. alte Leute gar nicht so relevant finden. Viele technische Einbauten, die sie unterstützen sollen, sind hochkomplex in der Bedienung. Betagten wäre es manchmal lieber, weniger Optionen oder Steuerungselemente zu haben und stattdessen Geräte, die große Knöpfe haben und einfach zu bedienen sind. Wichtig ist jedoch zu sagen, dass sich immer wieder gezeigt hat: Alles Entscheidende sollte von Anfang an gebaut werden! Jede Nachrüstung von Bauteilen oder Einrichtungen ist um ein Vielfaches teurer, als wäre es von Vornherein in der Planung geblieben.
Sie erwähnten, dass das Geriatrie-Personal mehr Platz für Materialien und das Unterstellen von Hilfsmitteln braucht. Sind diese Möglichkeiten nicht vorhanden, verschlechtert das die Arbeitsbedingungen und damit auch die Zufriedenheit des Personals. An welche Bedürfnisse sollte diesbezüglich mehr gedacht werden?
Es stimmt, dass unser Personal mindestens so viel wie in der anderen Medizinbereichen zu Fuß geht und verständlicherweise unzufrieden wird, wenn Korridore lang und Materialräume schlecht platziert sind. Es ist deshalb wirklich wichtig, wie ich schon sagte, die Abläufe mit den Betroffenen zu planen. Da die Pflegenden viel mehr in Kontakt zu Hausärzten stehen, brauchen sie auch ruhige und private Arbeitsräume für Telefonate und persönlichen Austausch. In einem Großraumbüro funktioniert das gar nicht.
In der Altersmedizin und in der Pflege gibt es sehr viele Gespräche mit betreuenden oder begleitenden Angehörigen. Einen Austritt zu planen, ist im Alter etwas ganz anderes. Und auch gestorben wird in der Geriatrie – für die Gespräche mit den Angehörigen brauchen wir also auch Räume, in denen diese würdig stattfinden können.

Im siebenstöckigen Neubau gibt es 176 Patientenzimmer, mehrere Gemeinschaftsräume und einen Dachgarten als Erholungs- und Begegnungsfläche. (Foto: Universitäre Altersmedizin Felix Platter)
Das ist sicher wünschenswert, doch es mangelt an genau diesen, spezifisch auf Altersbedürfnisse ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner. Sie setzen sich deshalb schon lange für den Aufbau von Lehrstrukturen ein, um die geriatrische Ausbildung in Europa voranzutreiben. Wie steht es heute darum?
Insgesamt ist es klar besser geworden. Man merkt, dass das Fach für die Spitalstruktur interessant geworden ist. Als ich 2003 in Deutschland anfing, gab es dort noch gar keine separate Geriatrie. Mit dem damals neu eingeführten DRG-System, also den Fallpauschalen, kommen wir in der Altersmedizin nicht weit: im Alter geht eine Lungenentzündung meist mit Komplikationen einher, es braucht eine geriatrische Frühkomplexbehandlung. Dafür benötigen wir Altersmediziner, und diese Spezialisierung war lange Zeit rar. Nun jedoch kommen viele Junge nach, der Bereich ist überproportional weiblich geprägt. Im Durchschnitt sind Frauen meiner Ansicht nach geeigneter dafür, haben einen holistischen Zugang und machen es besser.
Die Studentenausbildung bleibt jedoch durch Wechsel in der Lehre gefährdet. Da es zu wenige Altersmediziner gibt, werden Lehrstühle auch notgedrungen mit anderen Fachärzten besetzt, die dafür weniger geeignet sind. Die Altersmedizin ist – verglichen mit Gastroenterologie oder Kardiologie – keine Subspezialität, sondern vielmehr eine »Supraspezialität«. Den breiten Zugang, den wir für Altersmedizin genauso wie für Kindermedizin brauchen, bildet sich auch in der Behandlung ab. Doch während Behandlungen in der Kindermedizin weitestgehend linear ablaufen, ist das bei alten Menschen anders und es kommt im Rahmen der Behandlung häufig zu Abweichungen. Es gibt keine andere Gruppe, die so divers ist! Es gibt einfach nicht DEN alten Menschen. Und eine Krankenhausstruktur muss darauf eingehen.
Professor Dr. med. Cornel C. Sieber leitete von 2019 bis 2022 das Departement innere Medizin am Kantonsspital Winterthur KSW und ist seither ärztlicher Direktor für Kinder-, Jugend- und Altersmedizin. Sieber studierte Medizin in Basel und habilitierte dort, bevor er nach mehreren Jahren als Geriater in Genf 2001 den Lehrstuhl für Innere Medizin-Geriatrie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg übernahm und dort das Forschungsinstitut »Institut für Biomedizin des Alterns« aufbaute und weiter leitet.